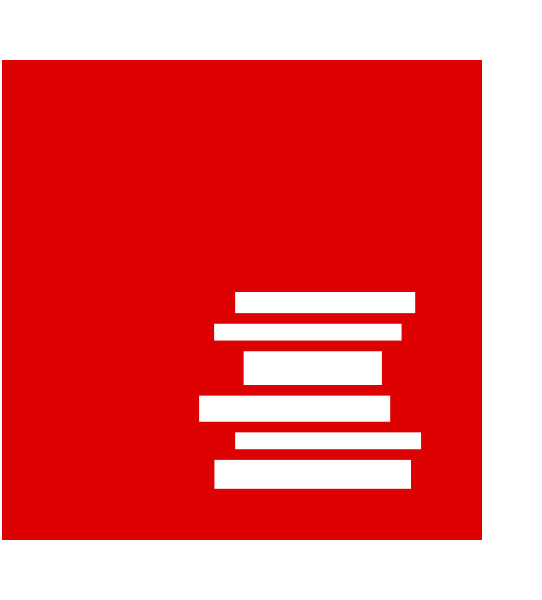Von Oliver Ruf
Die Koalitionsfraktionen der Bundesregierung wollen die Wissenschaftskommunikation in Deutschland stärken. Einen entsprechenden Antrag (Drucksache 20/10606) hat der Bundestag am 13. Juni 2024 mehrheitlich angenommen. Grundlage war eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung (Drucksache 20/11723). Das kann man als wichtigen Schritt zur Anerkennung, Professionalisierung und Förderung der Wissenschaftskommunikation betrachten – einerseits.
Andererseits sind viele der genannten Maßnahmen nicht sonderlich neu und wenig originell. An einigen Stellen scheint es beinahe, als sollten vor allem bereits begonnene Projekte des Forschungsministeriums abgesichert werden, statt sie kritisch auf den Prüfstand zu stellen. Die Opposition hat ihrerseits eine kleine Anfrage mit zahlreichen kritischen Nachfragen zum Ampelantrag eingereicht (Drucksache 20/1129). Vor allem aber bleibt unklar, welche echten Innovationen auf Basis des Beschlusses konkret auch für die Wissenschaftskommunikationsforschung initiiert werden können.
Die Initiatoren des Antrags haben das wichtige Thema der Wissenschaftskommunikation somit zwar erfolgreich in die bundespolitischen Entscheidungsgremien geführt – und dabei u.a. auch die dringende strukturelle Unterstützung eines unabhängigen Wissenschaftsjournalismus auf den Weg gebracht. Aber es ist noch nicht ersichtlich, wie sich auf dieser Basis auch das Wissenschaftssystem selbst und seine Kommunikation im Positiven verändern sollte. Hier hätte man etwa klare Anreize setzen können für eine redliche Wissenschaftskommunikation nach wissenschaftlichen (und auch normativen journalistischen) Standards, die anstelle einer „Heureka“-Reputationskommunikation von Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen eine (tatsächlich) informierende und zugleich reflektierte Form der Kommunikation mit der Öffentlichkeit fördert. Auch erscheint das vielversprechende Potenzial der Wissenschaftskommunikation für die Sozial- und Geisteswissenschaften (sowie deren Rückwirkung auf diese) nach wie vor als blinder Fleck. Kurz: Es gibt Nachholbedarf – und die Notwendigkeit, Wissenschaftskommunikation und ihre Erforschung weniger zu fetischisieren als vielmehr ernsthaft qualitätsgeleitet und disziplinenübergreifend zu denken.