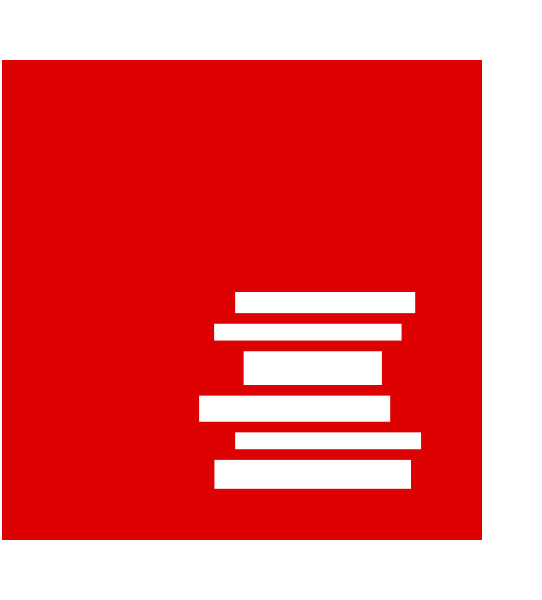Klaus Bilancicz ist 54 Jahre alt, verheiratet, von Beruf Bankkaufmann. Seine Freunde sind seit der Pandemie in vielen Telegram-Gruppen unterwegs – sodass er nun verstehen möchte, wie man echte wissenschaftliche Studien von Fake-Science unterscheidet. Im Internet hat er dazu Angebote seriöser Universitäten gefunden. Sein Problem: Texte mit Gendersternchen, die er dort entdeckt, liest er schon aus Prinzip nicht weiter.
Klaus Bilancicz gibt es nicht. Oder besser gesagt: Klaus Bilancicz gibt es schon, aber er (oder sie) heißt einfach nur anders. Konkret gehört die Figur zu einer Gruppe von „Personas“, wie man sie sich vorstellt, um passende Kommunikationsangebote für möglichst viele Zielgruppen zu entwickeln. Das können Durchschnittspersonen sein, aber auch superwoke Typen. Oder eben Menschen wie Klaus Bilancicz. Im progressiven akademischen Umfeld scheint aber bereits dann oft der Puls hochzugehen, wenn man auch nur vorschlägt, eine Person wie Klaus Bilancicz als Adressat von Kommunikationsformaten mitzudenken. Eine Diskussion über Sinn und Unsinn des umfassenden Genderns mit Stern in der externen Wissenschaftskommunikation gehört offenbar zu jenen Themen, die landläufig inzwischen als „Triggerpunkte“ bekannt sind. Im Sinne einer Kommunikation, die die Bevölkerung in ihrer Breite erreichen will, ist das aber ein Dilemma.
Wenn jemand Gendersterne ablehnt, kann das irrationale Gründe haben, Homo- oder Transphobie etwa. Die Ablehnung kann aber auch – ganz ohne erzkonservative Gesinnung – rational begründet sein: Etwa durch die Irritation, dass ein * in der wissenschaftlichen Literatur bereits für Fußnoten sowie in Lebensläufen und auf Grabsteinen für das Geburtsdatum steht. Wieder andere mögen das neue Schriftbild unästhetisch finden oder Sätze mit Sternenhaufen als schlecht lesbar. Auch könnten von Soziologen wie Steffen Mau beschriebene Phänomene einer „Veränderungserschöpfung“ vieler Menschen eine Rolle spielen – und weitere Gründe, die in einem interessanten Projekt gegen „Gender-Blindness“ in der Wissenschaftskommunikation, wie Olaf Kramer von der Universität Tübingen es nennt, untersucht werden sollen.
Unabhängig von den Gründen gilt es indes schon jetzt, mit der verbreiteten Ablehnung von Gendersternen konstruktiv umzugehen. Die aufgeklärte wissenschaftliche Community ist gegenüber derlei Befindlichkeiten allerdings oft nicht sonderlich kompromissbereit. Denn wir wissen es ja schließlich besser und haben gute Gründe (u.a. wollen wir mit unserer Sprache niemanden ausschließen…). Und dann hauen wir nicht selten auch entbehrliche Sterne rein in unsere Texte – womit wir dann zwar einige Gruppen vielleicht besser, die vielen Herrn Bilanciczs aber leider kaum mehr erreichen.
Vergleicht man diese Haltung mit sonst üblichen Tugenden der externen (Wissenschafts-)Kommunikation, so ist das verwunderlich. Da passen Forschende ihre Wissenschaftssprache der Sprache des Publikums an, vermeiden unnötige Fachbegriffe und akademischen Jargon; von „Zielgruppenorientierung“ ist dann die Rede, oder dass man die Leute dort „abholen“ möge, wo sie stehen. Immerhin sollen ja auch „underserved audiences“, nicht-akademische Personengruppen, angesprochen werden. Die aber sprechen in der Regel mit weniger Sternen als die akademische Welt.
Was also tun? Mal erscheint die Wissenschaftskommunikation diskriminierend gegenüber Gruppen, denen der Stern wichtig ist, mal respektiert sie nicht die Sprache der anderen, die man eigentlich auch erreichen sollte. Die deutschsprachigen Nachrichtenagenturen haben sich des Themas schon vor geraumer Zeit angenommen. Immerhin ist es für deren Kunden wie Zeitungsverlage ein Problem, wenn reihenweise Abos gekündigt werden, weil plötzlich Schreibweisen auftauchen, die viele Leserinnen und Leser ablehnen. Mit den Vorschlägen von dpa & Co kommt man schon recht weit, sodass man in vielen Fällen aufs Sterne-Gendern verzichten kann. Zugegeben, einige der Vorschläge machen die Sprache stilistisch auch nicht schöner, lassen sie kühler oder entpersonalisiert wirken – etwa, wenn „der Rat des Arztes“ nun zum „ärztlichen Rat“ wird und an Schulen statt Menschen nun „(Lehr-)Kräfte“ wirken. Andere gängige Empfehlungen, „Student*innen“ doch durch „Studierende“ zu ersetzen, lassen sich nicht beliebig übertragen: So war an der Uni Dortmund mal ein gut gemeintes Schild zu lesen, das Absolventen grammatikalisch ihres Abschlusses beraubte, indem es ihnen den Weg zum „Absolvierendentreffen“ wies. Und auch ein Fußballverein verfügt weiterhin über höchstens elf Spielende auf dem Platz, dazu über Auswechselspieler auf der Bank – die jedoch erst Auswechselspielende werden können, wenn jemand anderes den Platz verlassen hat.
Gute Kommunikation ist eben immer ein Kompromiss. Insofern ist es eine Überlegung wert, Texte (wie vielerorts üblich) nicht nur akribisch nach ungegenderten Stellen abzusuchen, sondern umgekehrt auch zu überlegen, wo man vielleicht mal ein Sternchen weglassen kann – etwa in zusammengesetzten Wortungetümen vom Typus „Nutzer*innenforscher*innen“. Auch spricht sich an den Hochschulen selbst „eine große Mehrheit von 62 Prozent der Befragten“ gegen verpflichtende Sprachregelungen aus, wie es in einer Anfang Oktober erschienenen Studie zur „Akademischen Redefreiheit heißt.
All das bedeutet nicht, dass man wegen Klaus Bilancicz auf eine diskriminierungssensible Sprache verzichten sollte. Die externe Wissenschaftskommunikation für die viel bemühte „breite Öffentlichkeit“ kann es sich aber nicht leisten, die unzähligen Verwandten der Persona Bilancicz zu ignorieren – abgesehen davon, dass man damit Futter für den Vorwurf eines angeblichen Genderwahns liefert, mit dem sich gefährlicher populistischer Wahlkampf betreiben lässt.
Hinweis: Der Text ist in einer ähnlichen Fassung am 14.10.2024 als Gastbeitrag im Berliner Tagesspiegel erschienen.