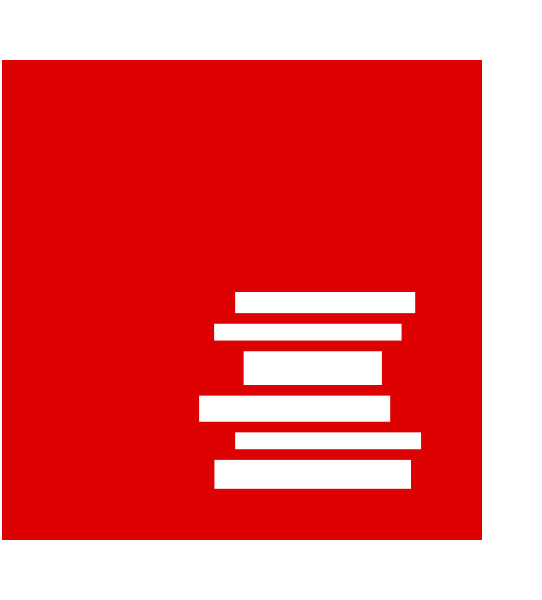Von Tobias Kreutzer
Weder Dr. Frankenstein noch Dr. Frank N. Furter haben sich in besonderem Maße um das Vertrauen der Allgemeinheit in die Wissenschaft verdient gemacht. Statt romantischer Überforderung mit der Moderne bei der literarischen Monster-Schöpferin Mary Shelley gibt es bei Richard O’Brien und Furter-Darsteller Tim Curry in The Rocky Horror Picture Show vor allem sexuelle Befreiung. Probandeneinwilligungen und Laborprotokolle sind indes in keinem der Fälle überliefert.
Dennoch oder gerade deshalb zieht es (oftmals verkleidete) Menschen kurz vor Halloween Jahr für Jahr in die saisonalen Aufführungen und Film-Screenings, unter anderem der Rocky Horror Picture Show. Das Interesse an den Toten, den nicht ganz so Toten und allem dazwischen ist groß und hat überraschend viel mit dem Heiligen Gral der Wissenschaftskommunikation zu tun: Wie gehen wir mit Unsicherheit und Nicht-Wissen um? Die Größte aller Unsicherheiten, die Frage nach dem ‚Danach‘, liefert hier einmal mehr passendes Anschauungsmaterial.
Wenn die Dunkelheit des Herbsts jeden wieder verstärkt auf sich selbst zurückwirft, bietet die Popkultur Zuflucht und Reflexion für derartige Gedanken. Neben den bereits genannten „mad scientists“ begegnen uns dort auch Praktiker zwischen Dies- und Jenseits, die mit bewährten Methoden und nach strikten Logiken für Ordnung zwischen den Welten sorgen. Das kann aus beiden Richtungen erfolgen. Die Beispiele der Ghostbusters und des nach dreieinhalb Jahrzehnten aktuell wieder im Kino polternden „Bio-Exorzisten“ Betelgeuse (sprich: „Beetlejuice“) zeigen diese Beobachtung popkulturell. Letztgenannter vertreibt die Lebenden, ausnahmsweise einmal umgekehrt, aus den Domizilen der Toten – und hat dabei jedoch die Rechnung ohne das menschliche „Handbuchwissen“ (Ludwik Fleck) gemacht. Das Handbook for the Recently Deceased bündelt Anwendungswissen über den Umgang mit der Welt der Toten und ihren Bewohnern und verleiht ihr damit gewissermaßen eine formale Logik. Beetlejuice macht es das Leben [sic!] schwer.
Die Angst vor dem Tod ist vor allem die Angst vor der Ungewissheit danach und die menschliche Faszination mit dem Morbiden zeugt auch von einer konstruktiven Auseinandersetzung mit dieser Ungewissheit. Entsprechend verweist das Stereotyp des „mad scientist“ nicht ausschließlich auf bei einigen Gruppen tiefsitzende Wissenschaftsfeindlichkeit, die es – und damit sind wir bei der Wissenschaftskommunikation – zu korrigieren gilt, sondern auch auf eine lebhafte Auseinandersetzung mit der Unmöglichkeit, die letzten Dinge zu durchdringen. Eine reflexive, transparente und prozessorientierte Wissenschaftskommunikation würde diese Debatten ohnehin nicht allein der Populärkultur und ihrer Rezeption überlassen, sondern sie proaktiv einbinden. Was nicht bedeutet, dass gewisse Schauerthemen nicht auch auf Themenebene als trojanisches Pferd für gehaltvolle Wissenschaftskommunikation funktionieren können: Auch außerhalb der „Spooky Season“ erreichen Forensik-Vorträge und YouTube-Kanäle mit Titeln wie „Wir Werden Alle Sterben“ ein bemerkenswert großes Publikum.