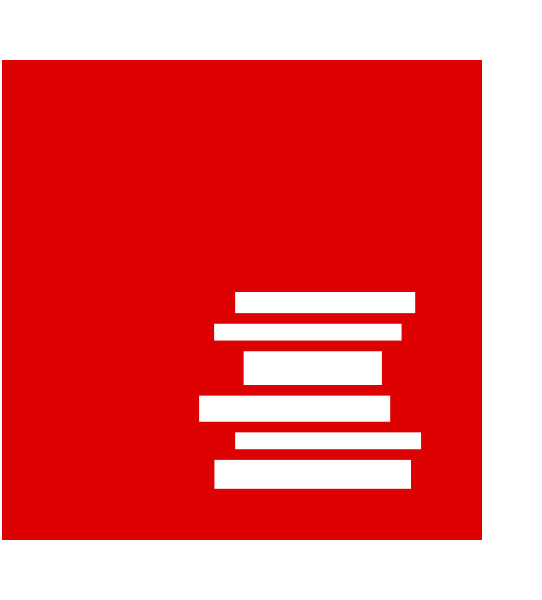Von David Kaldewey
Valentinstag! Am 14. Februar 2024 wurde in Berlin über „Exzellente Forschung in exzellenter Gesellschaft“ diskutiert. Zu der Podiumsdiskussion hatten eine Gruppe von Exzellenzuniversitäten (der Berliner Verbund, Aachen und Karlsruhe) sowie die Gesellschaft für transdisziplinäre und partizipative Forschung (GTPF) eingeladen. Auch wenn das Datum vielleicht nicht bewusst gewählt worden ist, so verführt es doch dazu, die Stoßrichtung der Veranstaltung als Beziehungsarbeit zwischen zwei wissenschaftspolitischen Buzzwords zu beschreiben: „Exzellenz“ trifft „Transdisziplinarität“. Wer von den beiden Blumen geschenkt und wer sie gnädig entgegengenommen hat, ist nicht leicht festzustellen. Mein persönlicher Eindruck war, dass sich die „Exzellenz“ über die Annäherung der „Transdisziplinarität“ freute, dass bei letzterer aber eine alte Enttäuschung durchschien darüber, dass die Beziehung bislang nicht so richtig leidenschaftlich werden wollte. Man kennt es: Oft ist es eben der eine Partner, der mehr Nähe will als der andere – und manchmal möchte der andere die Beziehung lieber etwas offener und unverbindlicher halten.
Ziel der Veranstaltung war eine Diskussion über eine „Erweiterung des Exzellenzbegriffes“ sowie die sich daraus ergebenden „Anpassungen im Wissenschaftssystem“ – so die Formulierung in einem Diskussionspapier, das vorweg an die angemeldeten Teilnehmenden verschickt worden war. Notwendig sei dies, weil im „aktuell gültigen Exzellenzverständnis“ Aspekte wie gesellschaftliche Verantwortung, Transdisziplinarität und Partizipation kaum eine Rolle spielten. Ein erweiterter Exzellenzbegriff müsse Transdisziplinarität nicht nur irgendwie an die Forschung ankleben, sondern Wissenschaft und Gesellschaft systematisch miteinander verzahnen.
Parallel dazu wurde aber auch mit einer etwas zurückhaltenderen Formulierung gearbeitet: Transdisziplinarität solle als „komplementärer Forschungsmodus“ anerkannt werden – neben der in der Exzellenzstrategie dominierenden Grundlagenforschung. Wenn man hier nochmal die Beziehungsanalogie heranzieht, deutet dies darauf hin, dass die Transdisziplinarität keine strikt exklusive Beziehung verlangt: Die Exzellenz bekommt weiterhin ihre Freiräume, aber es soll auch Zeiten der Zweisamkeit mit der neuen Partnerin geben.
Auffallend war, dass die Bedeutung von „Transdisziplinarität“ weitgehend als geklärt vorausgesetzt wurde. Hier scheint es inzwischen einen breiten Konsens über den Begriff sowie über das durch ihn abgesteckte Feld von Konzepten und Strategien zu geben. Weitere Schlüsselwörter in diesem Zusammenhang sind „Partizipation“, „soziale Innovation“ und „Reallabore“. In einer zuspitzenden Formulierung von Jan-Martin Wiarda, der die Runde moderierte, wurde von der „Gleichberechtigung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft“ gesprochen – verbunden mit der Frage, wie man diese denn nun erreichen könne.
Bei der „Exzellenz“ dagegen wurde die Bedeutung nicht vorausgesetzt, sondern umgekehrt gezielt problematisiert. Die Teilnehmer:innen auf dem Podium wurden gefragt, wie ein zeitgemäßes Verständnis von exzellenter Forschung aussehe. Die asymmetrische Reflexion des einen, aber nicht des anderen Begriffs überrascht insofern, als es durchaus auch Exzellenzuniversitäten gibt, die zwar von Transdisziplinarität sprechen, damit aber eher eine spannend klingende Variation der guten alten Interdisziplinarität meinen.
Die wissenschaftspolitische Botschaft der Veranstaltung war dennoch prägnant auf den Punkt gebracht: Um den Exzellenzbegriff zukunftsfähig zu machen, braucht er ein transdisziplinäres Update. Betont wurde auch, dass das Thema Transdisziplinarität bei den jüngst für die nächste Runde ausgewählten Clusterskizzen eine große Rolle gespielt habe. In der optimistischen Diagnose, dass die Universitäten hier auf dem richtigen Weg sind, steckte zugleich die Botschaft, dass dieser Weg auch etwas zielstrebiger verfolgt werden könnte.
Es lohnt sich, diesen Punkt etwas zu vertiefen: Wenn wir über Exzellenz sprechen, und das war bei dieser Berliner Runde nicht anders, dann sprechen wir fast immer auch über das konkrete Format der „Exzellenzcluster“ (in der offiziellen DFG-Abkürzung: EXC). Interessant ist aber auch, worüber umgekehrt nicht gesprochen wurde: In der guten Absicht, die Logik der Transdisziplinarität in das Format des Exzellenzclusters zu integrieren, fiel nämlich die Frage unter den Tisch, ob und inwieweit die Clusterförmigkeit der Forschung mit den Grundideen von Partizipation und gesellschaftlicher Verantwortung harmoniert. Ob die Beziehung von Exzellenz und Transdisziplinarität also die Chance hätte, zu halten, zu etwas ernstem zu werden.
Hier zeigt sich eine implizite Diskursprämisse: Exzellenzcluster sind für die Universitäten ebenso wie für die Forschenden die Leitwährung im Wettbewerb um Reputation und Status. Während in den alten Debatten um Interdisziplinarität und transformative Forschung immer auch kritisch darauf hingewiesen wurde, dass die nach Disziplinen sortierten und für die Reputationszuweisung zuständigen Top-Journals alternative Karrierewege für inter- und transdisziplinäre Nachwuchswissenschaftler:innen erschweren, wird die strukturell ähnlich gelagerte Reputationsmonopolisierung bei den Exzellenzclustern kaum problematisiert: Allein, damit Forschungsideen in die Form eines Clusters passen und den Segen sowohl der Hochschulleitungen wie der internationalen Gutachter:innengremien erhalten, muss an vielen Schrauben gedreht werden – denn ohne Kompromisse geht es hier nicht. Das Prinzip der profilbildenden Verbundforschung bedeutet beispielsweise, Themen zu abstrahieren, hochzuskalieren und möglichst viele prominente Kolleg:innen in das Projekt einzubinden – unabhängig davon, ob die eigentliche Forschungsidee in genau diesem Großformat am besten gedeiht oder doch eher verwässert wird.
Auf das Kernthema der Beziehung zwischen Exzellenz und Transdisziplinarität bezogen wäre also zu reflektieren, ob und wenn ja unter welchen Bedingungen Exzellenzcluster das angemessene und anzustrebende Format für transdisziplinäre Projekte sind. Hier wäre es sicher sinnvoll, wenn sich das ungleiche Paar gut beraten lässt, bevor es sich dauerhaft bindet. Ansonsten könnte sich der Cluster, in den die beiden im Erfolgsfall einziehen, als ein Zuhause erweisen, in dem nicht beide glücklich werden. Und wenn die Beziehung dann scheitert und einer wieder auszieht, bleibt der andere auf den offenen Hypotheken sitzen.
Der Beitrag ist eine überarbeitete Fassung des erstmals am 15.02.2024 auf LinkedIn veröffentlichten Artikels.