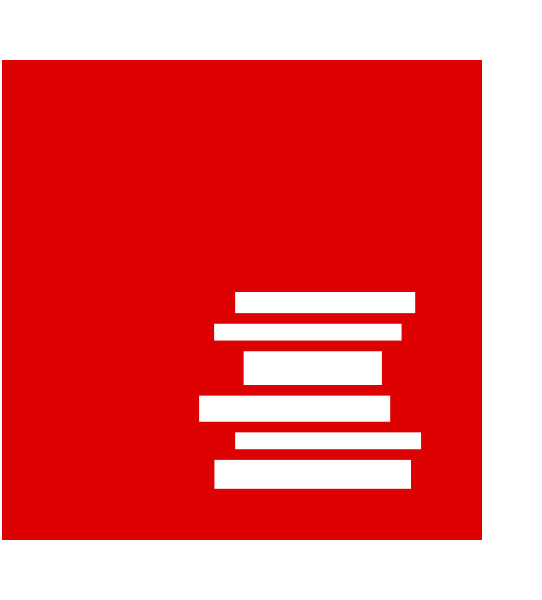Von David Kaldewey
18.09.2024
An einem Mittwoch im August, fast unbemerkt in der Sommerpause, druckte die FAZ einen wissenschaftspolitischen Gastbeitrag mit dem provokanten Titel „Plädoyer für eine Exzellenzpause“. Der Artikel erschien damit kurz vor der am 22. August 2024 anstehenden Deadline für die Einreichung von 98 Clusteranträgen im Rahmen der Exzellenzstrategie; von diesen sollen ab 2025 voraussichtlich etwa 70 mit insgesamt 529 Millionen Euro pro Jahr gefördert werden. Man kann vermuten, dass viele hunderte antragschreibende Wissenschaftler keine Zeit hatten, an Ferien zu denken.
Der Autor des FAZ-Beitrags, Thorsten Wilhelmy, ist ein ausgewiesener Kenner des deutschen Wissenschaftsbetriebs. 2023 konnte ihn die Einstein Stiftung Berlin als Geschäftsführer gewinnen, zuvor war er unter anderem beim Wissenschaftsrat in Köln und beim Wissenschaftskolleg in Berlin tätig. Wilhelmy ist ein „Insider“, der zugleich aber die Universitäten (um die es ja geht in der Exzellenzstrategie) eher von „außen“ beobachtet. Und vielleicht kann er genau deshalb Dinge aussprechen, über die man an den Universitäten selbst, zumindest auf den höheren Ebenen, lieber schweigt.
Wilhelmys Beitrag adressiert das altbekannte Dilemma der Grundfinanzierung der Universitäten in einem föderalen System: Den sinkenden Grundhaushalten (verantwortlich hierfür sind die Länder) stehen steigende Anteile von Drittmitteln (die primär vom Bund bereitgestellt werden) gegenüber. Eine Gruppe von gewerkschaftsnahen Akteuren hat vor diesem Hintergrund ein „lernendes Manifest“ verfasst und einen Systemwechsel gefordert: Die Mittel des Bundes, die insbesondere über die DFG verteilt werden, müssten in die Grundfinanzierung der Hochschulen „zurückgelenkt werden“. Dahinter steht allerdings, wie Wilhelmy zu Recht bemerkt, eine grundsätzliche Wettbewerbsskepsis, der er sich nicht anschließen möchte. Zugleich stellt er fest – und diese Beobachtung mag überraschen – dass der eher „systemkonservative“ Wissenschaftsrat in seinem Positionspapier zu den Strukturen der Forschungsförderung (Januar 2023) im Kern eine ähnliche Diagnose gestellt hatte: „Das aktuelle System der Forschungsfinanzierung, in dem Drittmittel ein ähnliches Gewicht gewonnen haben wie Grundmittel für Forschung, ist an seine Grenzen gelangt“.
Vor dem Hintergrund dieses Dilemmas überlegt nun Wilhelmy, ob es einen Weg geben könnte „die Mittel des Bundes im System zu halten und gleichzeitig den zu Recht als überhitzt beschriebenen Wettbewerb partiell abzukühlen“. Ansätze für eine Lösung findet er im zitierten Positionspapier des Wissenschaftsrates vorgezeichnet: Durch eine Erhöhung der DFG-Programmpauschalen von 22% auf 40% könne mehr Geld in Grundhaushalte der Universitäten gelangen, ohne dass dabei das Wettbewerbsprinzip in Frage gestellt würde. Finanzierbar wäre die Idee ganz einfach dadurch, dass der Exzellenzwettbewerb nach der aktuellen Runde pausiert und die eingesparten Mittel der DFG für die regulären Programme und erhöhten Overheads zur Verfügung gestellt würden.
Der Vorschlag ist aus verschiedenen Gründen elegant. Erstens könnte es so gelingen, an den produktiven Aspekten des Wettbewerbsprinzips festzuhalten, zugleich aber problematische Nebenfolgen zurückzufahren. Zweitens ließe sich das Ganze ohne grundsätzliche Reformen des föderalistischen Prinzips oder radikale Umbauten der wissenschaftspolitischen Institutionen umsetzen. Drittens würde durch die stärkere Fokussierung des Wettbewerbs auf die vielfältigen DFG-Formate der phasenweise extreme Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit ExStra-Aktivitäten reduziert, was zu einer Freisetzung von produktiver Arbeitszeit führen würde. Viertens hätten Universitäten bei höheren Overheads größere Freiheiten der Mittelverwendung als in den projektgebundenen Geldern, die etwa in der Linie „Exzellenzuniversitäten“ beantragt werden können. Bislang mussten sich die Hochschulleitungen im Blick auf diese zweite Förderlinie ständig neue Projekte und Ideen ausdenken, um zu begründen, wofür jährlich nochmal 10 bis 15 Millionen ausgeben werden könnten. Bei den erfolgreichen Exzellenzuniversitäten sind die Folgen deutlich sichtbar: neue Zentren, Programme, außerplanmäßige Ad-hoc-Berufungen von Superstars, Wachstum von neuen Organisationseinheiten, mehr Veranstaltungen, exzessive PR (getarnt als „Wissenschaftskommunikation“) und weitere Strohfeuer – und all das soll dann bitte von den Wissenschaftler:innen bespielt, genutzt und besucht werden. Die durch die vielen Anträge bereits strapazierten Arbeitszeitkonten der Wissenschaftler:innen werden also in der Folge erfolgreicher Exzellenzanträge nochmal zusätzlich in Mitleidenschaft gezogen.
Auf dem Tisch liegt also ein provokativer, aber zugleich fundierter und durchdachter wissenschaftspolitischer Vorschlag, über den sich sinnvoll diskutieren lässt. Umso spannender ist die Frage, wie der wissenschaftspolitische Betrieb darauf reagiert hat. Um es kurz zu halten: es ist still geblieben. Werfen wir zunächst einen Blick auf die sozialen Medien: Auf X/Twitter kann man die Likes an einer Hand abzählen. Der einzige inhaltliche Kommentar stammt vom „Netzwerk für Gute Arbeit in der Wissenschaft“, das den Vorschlag als „kaum besser als der Ist-Zustand“ abtut und die Notwendigkeit einer grundlegenderen Reform betont. Auf LinkedIn ist der Beitrag ein paar mal geteilt worden, zusammengenommen lassen sich aber gerade mal 63 Likes zählen (Stand 18. September). Jeder inhaltsfreie Post nach dem Muster „ich bin hier mit auf der Veranstaltung XY und habe YZ getroffen es ist supernett und inspirierend“ hätte mehr Resonanz erzeugt.
Was sagen die angesprochenen Institutionen? Vom Wissenschaftsrat und der DFG hört man nichts, aber das mag natürlich auch daran liegen, dass diese sich selten ad hoc in öffentliche Debatten einbringen. Ob und wenn ja wer intern mit wem worüber spricht, wäre eine andere Frage, über die hier nicht spekuliert werden soll. Besonders auffällig ist allerdings die Reaktion einer anderen Gruppe von Stakeholdern: Die Universitäten. Auch von diesen hört man – nichts.
Lediglich auf Research.Table, einem kommerziellen Newsletter-Angebot, finden sich Reaktionen: zwei von den ehemaligen Bundesforschungsministerinnen Schavan und Bulmahn, eine von vom Generalsekretär der VolkswagenStiftung, Georg Schütte. Letzterer stimmt Wilhelmy zwar zu und bestätigt die Gefahr einer Überhitzung des Wissenschaftssystems. Die Frage, wie es weitergehen soll, beantwortet er allerdings anders: Aus seiner Sicht werden künftig mehr strategische Prioritätensetzungen gefordert sein – und um diese zu treffen, müsse die „Exzellenzlogik“ um eine „Wirkungslogik“ ergänzt werden. Übersetzt heißt das: Weniger reine Grundlagenforschung, dafür mehr Translation, mehr Impact, mehr Transdisziplinarität und mehr Forschung für die Gesellschaft. Das ist ein wichtiger Punkt (siehe ExStra-Blatt Folge 2), betrifft im Kern aber gar nicht Wilhelmys Vorschlag. Annette Schavan, Bundesministerin von 2005 bis 2013, bevor sie 2014 deutsche Botschafterin beim Heiligen Stuhl wurde, kritisiert an Wilhelmys Vorschlag, dass eine langfristige Perspektive fehle. Auch bleibe die Frage offen, wie die Finanzierung nach 2040 (!) gesichert werden könne. Vielleicht ist das die Art von überzeitlichem Denken, das man im Vatikan lernt, aber der genannte Zeithorizont scheint doch an den Realitäten der möglichen Vorausplanung im Politikbetrieb hinauszugehen. Das Interview mit Edelgard Bulmahn, Bundesministerin von 1998 bis 2005 (O-Ton Table.Briefings: „Alle reden über die Exzellenzstrategie, sie hat sie erfunden“), verteidigt im Kern die damals angestoßenen Veränderungsprozesse des Wissenschaftssystems und plädiert „unbedingt“ für eine Fortsetzung. Denkbar sei aber eine Neujustierung der Schwerpunkte.
Alle drei Table.Research-Beiträge bestätigen den bereits bei der Auswertung der sozialen Medien gewonnenen Eindruck, dass der FAZ-Beitrag von Thorsten Wilhelmy etwas ist, über das man lieber nicht konkret diskutiert. Womöglich ist die Exzellenzstrategie längst ein Glaubenssatz, an dem man nicht rütteln kann, ohne Verdacht auf sich selbst zu lenken – nach dem Motto: „Eine Exzellenzpause? Findest Du gut? Ah, Du bist wahrscheinlich nicht so richtig fit für den Wettbewerb?“ Schon ein öffentliches „like“ auf X oder LinkedIn für einen exzellenzkritischen Beitrag wäre insofern verdächtig. Noch schwerer haben es die Universitätsleitungen: Wer hier die ExStra nicht offiziell toll findet, steht fast zwangsläufig unter Verdacht, an der Exzellenzfähigkeit der eigenen Organisation zu zweifeln.
Eine Folge dieses Schweigens ist auch, dass – trotz des viel beschworenen Begriffs der „Audit Society“ – niemand ernsthaft auf eine grundlegende Evaluation oder gar ein Controlling der Exzellenzstrategie pocht. Schon als junger Wissenschaftsforscher war das immer wieder überraschend für mich. Ich erinnere mich an einen E-Mail-Austausch mit jemanden, der das deutsche Wissenschaftssystem viel besser kennt als ich und schon lange in verschiedenen Rollen dabei ist im Betrieb. Er erläuterte die Problematik nüchtern in einem Satz: „Es scheint, als hätten sich nach den Debatten beim Start (Münch et al.) alle darauf verständigt, das Programm zu affirmieren: die Gewinner, weil sie profitieren; die Verlierer, weil sie nicht als solche wahrgenommen werden wollen; die Politik, weil ein möglicher Fehler diesen Ausmaßes nicht passieren kann; DFG und WR, weil sie Verfahrensbeteiligte sind usf.“